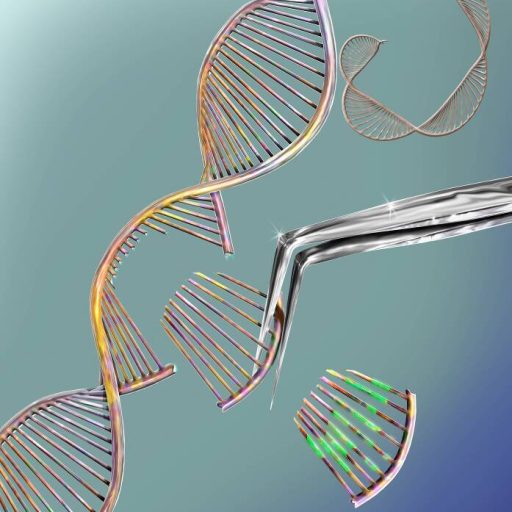Text: Thomas Wagner-Nagy
Jedes Jahr sterben schätzungsweise 100 000 Menschen an Schlangenbissen. Etwa 400 000 tragen bleibende Schäden davon. Auch Spinnenbisse und die Stiche mancher Quallen- und Skorpionarten können Betroffene das Leben kosten.
Tierische Gifte sind meist komplexe Gemische aus organischen Stoffen wie Proteinen, die biologische Prozesse im Körper der Opfer fehlleiten oder blockieren. Da sie selbst innerhalb einer Tiergattung stark in Aufbau und Wirkungsweise variieren können, gibt es kaum allgemeingültige Eigenschaften, die auf alle Toxine zutreffen. Gegengifte sollen die Wirkung der Substanz verringern. Das kann auf verschiedene Arten geschehen, etwa indem sie den Giftstoff an sich binden, ihn in eine weniger giftige Substanz umwandeln, ihn vom Ort seines Wirkens verdrängen oder seine Verstoffwechselung und Ausscheidung beschleunigen.
Gegengifte sollen die Wirkung der Substanz verringern
Naturgifte bekämpft man mit Antikörpern: Sie docken passgenau an die toxischen Moleküle an und setzen sie so außer Gefecht.Um solch ein Gegengift herzustellen, braucht man zunächst das entsprechende Gift.
Wir melken unsere Schlangen nur einmal im Monat. Nur so reichern sie ein qualitativ hochwertiges Gift an.
Chris Hobkirk, Schlangenmelker
Bei Schlangen wird es von Schlangenmelkern wie dem Südafrikaner Chris Hobkirk gewonnen. Dazu packen sie das Tier am Kopf und lassen es auf ein mit Folie überzogenes Gefäß beißen. Das austretende Gift fließt in den Becher. Um die Ausbeute zu erhöhen, kann zusätzlich von außen etwas Druck auf die Giftdrüsen ausgeübt werden. Doch selbst so kommt man nur auf ein paar Tropfen. Man braucht also nicht nur gute Nerven, sondern auch eine Menge Geduld, bis man Mengen erreicht, mit denen man im großen Maßstab arbeiten kann. »Wir melken unsere Schlangen nur einmal im Monat. Nur so reichern sie ein qualitativ hochwertiges Gift an«, erklärt Hobkirk. »Bei häufigerer Entnahme würden wir ein verdünntes Gift erhalten, das sich nicht zur Weiterverarbeitung eignet.«

Melken einer Klapperschlange
Bei anderen Tierarten ist die Giftentnahme nicht weniger heikel. Spinnen etwa werden hierzu mit Gas betäubt und ihre Giftdrüsen durch einen leichten Stromfluss stimuliert, wodurch einige Tropfen Gift abfließen. Eine weitere Methode besteht darin, die Spinne so lange zu provozieren, bis sie von selbst Gift abgibt, um dann darauf zu hoffen, die winzigen Tröpfchen im richtigen Moment mit einer Pipette direkt an den Giftklauen aufsaugen zu können.

Mit einer Pipette fängt ein Forscher das Nervengift an den Giftklauen einer australischen Trichternetzspinne auf.
Hat man das gewünschte Gift entnommen, gleichen sich die weiteren Schritte für alle Gegengifte. Es wird zunächst gefriergetrocknet, um ihm das Wasser zu entziehen und es haltbar zu machen. Sobald genug Gift zusammengekommen ist, kann die Antikörper-Produktion beginnen. Dazu setzt man Tiere, meist Pferde oder Schafe, dem Gift in stark verdünnter Form aus. Sie erhalten über mehrere Wochen verteilt Injektionen. Als Abwehrreaktion gegen das Gift bildet ihr Immunsystem Antikörper. Wenn diese nach einigen Monaten ihren Höchstwert erreichen, werden sie aus dem Blut extrahiert und gereinigt. Abschließend wird ihre Konzentration spezifisch angepasst, bevor sie abgefüllt werden.
Zeit ist oft der wichtigste Faktor bei der Behandlung von Vergiftungen
Das fertige Gegengift wird entweder als Flüssigkeit in Ampullen oder entwässert in Pulverform aufbewahrt. Das Pulver ist auch bei höheren Temperaturen haltbar, was gerade für abgelegene Regionen mit heißem Klima wichtig ist. Sein großer Nachteil: Es muss vor der Verabreichung wieder in Wasser aufgelöst werden. »Dazu rollt man das Gefäß behutsam und darf nicht schütteln, um Bläschenbildung zu vermeiden«, erklärt Schlangenfänger Arno Naude. »Das dauert bis zu eine halbe Stunde. So viel Zeit hat man aber bei vielen Schlangenbissen nicht.«
Zeit ist oft der wichtigste Faktor bei der Behandlung von Vergiftungen. Denn Gegengifte können die toxischen Stoffe weder zerstören noch bereits angerichtete Schäden rückgängig machen.
Schwierigkeit: Unterschiedliche zusammengesetzte Gifte
Eine weitere Tücke bei der Produktion: Selbst Schlangen innerhalb derselben Art haben mitunter sehr unterschiedlich zusammengesetzte Gifte. Das liegt vermutlich an unterschiedlichen Lebensräumen und Beutetieren. So enthalten die Gifte einiger Arten mancherorts viele Neurotoxine, um das Nervensystem ihrer Beute lahmzulegen und sie schnell bewegungsunfähig zu machen. Andere Populationen können es sich hingegen leisten, ihre Beute nach einem Biss zu verfolgen; sie setzen stärker auf Hämotoxine, die Gerinnung oder Sauerstofftransport des Blutes stören, oder Cytotoxine, die Körperzellen absterben lassen.
Worauf diese Variabilität beruht, ist nach wie vor ein großes Rätsel. Die Evolution spielt sich hier gewissermaßen vor unseren Augen ab.
Dietrich Mebs, Autor, Forensiker und Toxikologe
»Worauf diese Variabilität beruht, ist nach wie vor ein großes Rätsel. Die Evolution spielt sich hier gewissermaßen vor unseren Augen ab«, erklärt Dietrich Mebs. Er ist Autor des Standard-Nachschlagewerks »Gifttiere« und erforscht als Forensiker und Toxikologe seit Jahrzehnten Giftstoffe. Um diese regionalen Unterschiede auszugleichen, verwende man immer Tiere von unterschiedlichen Fundorten und mische deren Gifte, sagt Naude. Oft stelle sich jedoch ein größeres Problem: »Bei der Hälfte der Bissfälle wissen wir gar nicht, mit welcher Art wir es zu tun haben.« Dann müsse man durch Befragung, Bissspuren und Symptome rekonstruieren, was passiert sei.
Antiseren für Bissfälle mit unklarer Herkunft
Auch für diese Fälle ist die Medizin gewappnet, indem sie Antiseren mischt. Solche polyvalenten Gegengifte decken typischerweise die für den Menschen gefährlichsten Schlangenarten in einer Region ab. In Südafrika umfasst das Antiserum fünf Kobra-, drei Mamba- und zwei Vipern-Arten. Das Immunserum »Europa« deckt fünf auf unserem Kontinent heimische Giftschlangenarten ab.

Der Antidot-Hersteller Venom World züchtet Giftschlangen wie diese Amerikanische Lanzenotter.
Aufgrund der aufwendigen und teuren Herstellung herrscht auf dem Weltmarkt ein chronischer Mangel an Gegengiften. Das nutzten viele schamlos aus, beklagt Mebs. »Auf dem Weg vom Produzenten zum Farmer in einem anderen Land verfünffacht sich der Preis einer Ampulle auf etwa 500 Dollar«, sagt der Forscher.
Der Zwang, Profite zu machen, hat verheerende Auswirkungen. »Wenn eine Schlangenart nur etwa 200 Menschen im Jahr beißt, ist es schlicht unmöglich, das in die Antidot-Entwicklung investierte Geld zurückzubekommen«, erklärt Naude. Zudem würden keine Gegengifte für Arten produziert, deren Biss nur selten tödlich ist, jedoch schwere bleibende Schäden verursachen kann. »Diese Fixierung auf Todesfälle ist ein Problem, denn die Leute sterben dann zwar nicht, tragen aber mitunter Behinderungen für den Rest ihres Lebens davon.«
Lange Entwicklungszeiten und hohe Kosten sind ein Problem
Diese Zustände veranlassten die Weltgesundheitsorganisation 2017 dazu, Vergiftungen durch Schlangenbisse in ihre Liste der vernachlässigten Tropenkrankheiten aufzunehmen. Auch in der Forschung vernachlässige man natürliche Gifte, meint Dietrich Mebs. Denn obwohl sie ein enormes Potenzial für die Arzneimittelentwicklung böten, hätten es in den vergangenen 50 Jahren gerade eine Handvoll Substanzen aus diesem Bereich bis zur Marktreife geschafft. »Angesichts der langen Entwicklungszeit und der hohen Kosten trauen sich viele Forscher gar nicht an Gifte heran«, erklärt Mebs.
Während es für die häufigsten Schlangenbisse immerhin Gegengifte gibt, sieht es bei anderen Gifttieren schlecht aus. Wer in Australien von bestimmten Quallen oder einem Blaugeringelten Kraken erwischt wird, hat ohne schnelle Beatmung schlechte Überlebenschancen. Die Giftwirkung setzt schnell und heftig ein, Antidote sind nicht vorhanden. In unseren Breiten kann beispielsweise eine Knollenblätterpilz-Vergiftung tödlich enden. »In den ersten drei bis vier Tagen merkt man fast nichts, dann versagt die Leber, und es hilft nur eine Transplantation«, erklärt Mebs. Wegen der geringen Fallzahlen lohne sich eine Gegengift-Produktion jedoch nicht.
Wie Giftdrüsen aus der Petrischale Antidote für tödliche Toxine liefern könnten, lesen Sie in P.M. 11/2020.