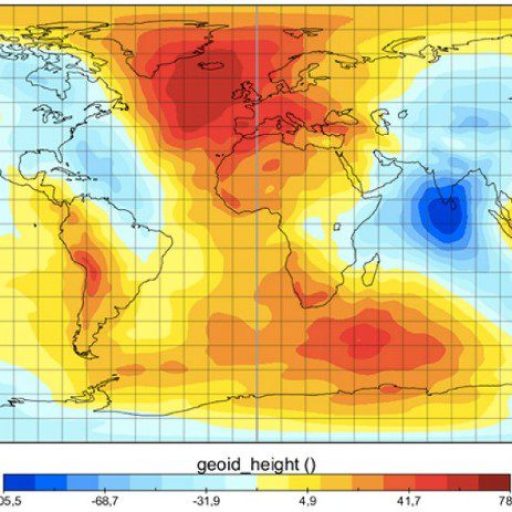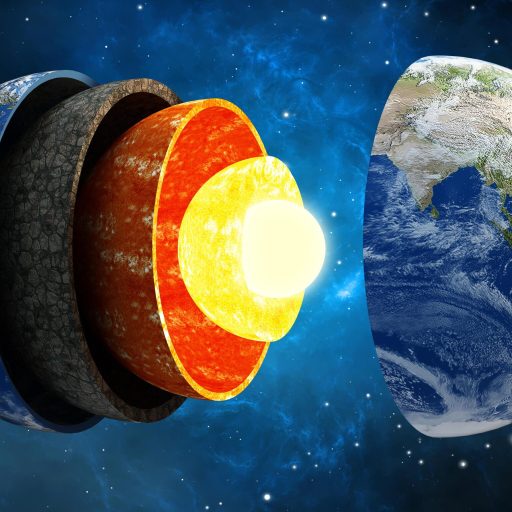(Text: Tim Kalvelage)
Jedes Tier spielt in der Natur eine bestimmte Rolle: So wirken Pflanzenfresser oft als Landschaftsgärtner, Fleischfresser dienen der Populationskontrolle, Aasfresser als Gesundheitspolizei. Einige Arten jedoch sind für die Funktion eines Ökosystems wichtiger als andere.
Diese »Schlüsselarten« verleihen einem Lebensraum Stabilität, so wie der Schlussstein einen Rundbogen vor dem Kollaps bewahrt. Entfernt man sie, verändert sich das System dramatisch und büßt an Biodiversität ein.
Ökologen nutzen das Wissen um Schlüsselarten
Der Ökologe Robert Paine (Bild u.) beobachtete das Phänomen erstmals in den 1960er-Jahren bei Experimenten in Gezeitentümpeln an der US-Pazifikküste. Paine befreite einige der Gewässer von Seesternen, die darin am oberen Ende der Nahrungskette standen. Ohne den Spitzenräuber kippte das ökologische Gleichgewicht. Von 15 verbliebenen Arten verschwanden erst Makroalgen, später Anemonen, Schnecken und andere Meerestiere. Nach fünf Jahren lebten nur noch Muscheln in den Becken.

Inzwischen haben Forscher zahlreiche Schlüsselspezies identifiziert. Ihre Bedeutung für ein Biotop zeigt sich oft erst über lange Zeiträume: Nachdem etwa die Seeotter auf den Aleuten im Beringmeer fast ausgerottet wurden, vermehrte sich ihre bevorzugte Beute – Seeigel – massenhaft und fraß artenreiche Kelpwälder kahl. In der Serengeti zählen Büffel und Gnus zu den Schlüsselarten: Nachdem ihre Herden sich in den 1980er-Jahren von der Rinderpest erholten, verwandelte sich die Buschlandschaft wieder in eine endlose Grasebene. In der Folge kam es seltener zu verheerenden Buschbränden.
Ökologen können das Wissen um Schlüsselarten nutzen: Im Yellowstone- Nationalpark etwa siedelten sie wieder Wölfe an, um die massenhafte Vermehrung von Wild einzudämmen. Dort wachsen nun wieder mehr Bäume.
Der Artikel ist in der Ausgabe 04/2021 von P.M. Fragen & Antworten erschienen.