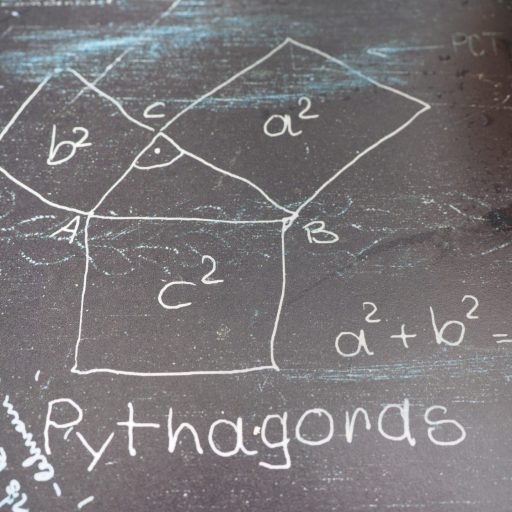Text: Ulf Schönert
Als alles zu Ende scheint, ist die arktische Nacht bereits hereingebrochen. Das Thermometer zeigt minus 20 Grad, die Seeleute sind so erschöpft, sie können sich kaum auf den Beinen halten. Drei Tage haben sie geschuftet, um den Untergang ihres Schiffs zu verhindern. Mit Lenzpumpen haben sie versucht, das Wasser aus dem Schiffsrumpf zu schaffen. Im eiskalten Meer haben sie das Leck gesucht, das sich unter der Wasserlinie befinden muss. Schließlich haben sie die wertvollsten Dinge von Bord geschleppt, und dann auch die weniger wertvollen.
Noch hält sich die Hansa über Wasser, hält die Verbindung zu der Eisscholle, an die sie festgemacht ist und auf die sich die Männer gerettet haben. Doch das Eis, das den Schoner umgibt, drückt erbarmungslos auf die Planken. An mehreren Stellen – niemand weiß, wo genau – ist das Holz geborsten.
Die Ratten verlassen das sinkende Schiff
Draußen auf der Eisscholle stapelt sich Ausrüstung, die gerettet werden konnte. Proviant, Mäntel, Kohlebriketts, astronomische Geräte. Dazwischen huschen Ratten. Sie haben das Schiff längst verlassen. Zitternd sterben sie den Kältetod auf dem Eis. Es ist aus.
Um sechs Uhr abends verkündet der Kapitän die Aufgabe der Hansa. Er lässt die Taue kappen, denn er fürchtet, das sinkende Schiff könnte die Eisscholle, die letzte Zuflucht der Mannschaft, mit sich reißen. Dann schickt er die Männer in ihr provisorisches Notquartier – eine ein paar Hundert Meter entfernt gelegene Hütte aus Kohlebriketts. Nicht mal eine Wache bleibt am Schiff. Alle müssen jetzt schlafen.
Als die Sonne aufgeht, ist die Hansa im schwarzen Wasser des Polarmeers verschwunden. Und die Schiffbrüchigen sind ohne Aussicht auf Rettung auf einer Eisscholle, irgendwo vor Grönland. Es ist der 21. Oktober 1869. Niemand auf der Welt weiß von ihrem Schicksal. Und der Winter hat noch nicht einmal begonnen.
Die Hansa ist als Begleitschiff der Germania auf dem Weg zu einer Nordpolarexpedition
Wie stolz war die Hansa gewesen, als sie, nur vier Monate zuvor, in Bremerhaven aufgebrochen war! Geschmückt mit bunten Flaggen vom Bug bis zum Heck. Tausende hatten am Ufer Abschied genommen, Böllerschüsse waren gefeuert worden. Alles, was in Preußen Rang und Namen hatte, war gekommen: Helmuth Graf von Moltke, der Sieger von Königgrätz. Otto von Bismarck. Und sogar König Wilhelm! Sie alle wollten die beiden Schiffe der zweiten deutschen Nordpolarexpedition, neben der Hansa auch ihr Schwesterschiff Germania, verabschieden. Denn Polarforschung, das war zuvor stets eine Domäne anderer Nationen gewesen. Im hohen Norden hatten Engländer, Holländer und Norweger Berge und Fjorde nach ihren Königen benannt. Nun wollten auch die Deutschen mitmischen. Die 1860er-Jahre waren eine Zeit des nationalen Taumels in Europa, aber besonders in Preußen. Nach Siegen gegen Österreich und Dänemark träumten viele vom entscheidenden Schlag gegen den französischen Erzfeind, von der Einigung aller Deutschen in einem Nationalstaat und vom Aufstieg zur Großmacht.
Auch August Petermann war begeistert von der nationalen Sache. Noch mehr als von Preußens Gloria aber träumte der Geograf von der Eroberung des Nordpols. Wie viele andere Gelehrte war auch er der Ansicht, hinter dem grönländischen Packeis gebe es ein eisfreies Meer bis zum Pol.
Im ganzen Land sammelte er Spenden – und schickte 1868 eine erste deutsche Nordpolarexpedition in See. Mit vielen Erkenntnissen kam sie zurück. Doch den Pol hatte sie ebenso wenig erreicht wie das eisfreie Nordmeer.
Also musste eine zweite Expedition her. Petermann heuerte erneut Matrosen und Wissenschaftler an und gab den Bau des Dampfschiffs Germania in Auftrag. Im April 1869 war das Schiff nach fünf Wochen Bauzeit fertig. Doch die Germania brauchte ein Begleitschiff: die Hansa. Petermann kaufte sie für 8000 Taler gebraucht – zuvor hatte sie Fulton geheißen. Wie schon die Germania wurde auch die Hansa mit zusätzlichen Planken aus Eiche, einer „Spikerhaut“, geschützt. Innen zogen Zimmerleute Querbalken ein, um zu verhindern, dass Packeis das Schiff zerquetscht. Außerdem bekam die Hansa drei Beiboote an Deck.
Der Kapitän Friedrich Hegemann plant eine mögliche Überwinterung mit ein
Als Kapitän bestimmte man Friedrich Hegemann, einen kernigen Typen, hager, mit strengem Scheitel und grimmigem Gesicht. Erst im Herbst war er aus der Beringstraße zurückgekehrt, die er sechs Jahre befahren hatte. Überwintert im Eis hatte jedoch noch keiner der Teilnehmer. Diese Möglichkeit aber kalkulierte Petermann ein: Vorsichtshalber legte er Heuer für zwei Jahre bereit. Die Seeleute ließ er sich schriftlich mit einer möglichen Überwinterung einverstanden erklären. Wohl wissend, dass das gefährlich war: Das spektakuläre Ende der Expedition des Briten John Franklin, dessen Schiffe Erebus und Terror 1847 spurlos im Eis verschwanden, lag nicht lange zurück.

Die Mannschaft der Hansa besteht aus Seeleuten, Handwerkern und Wissenschaftlern. Erfahrung mit Polarfahrten hat aber kaum jemand
An mangelnder Ausrüstung jedenfalls sollte es nicht scheitern. Konserven, Gläser und Kisten mit Erbsen, Kartoffeln und Kohl ließ Petermann an Bord bringen. 20 Pfund Ochsenzungen. 36 Schinken. 6400 Pfund Keks. Außerdem „gute Getränke“: 60 Flaschen Cognac, 348 Flaschen Sherry, 16 Kisten Spirituosen – unter anderem. Dazu viele „Irländerjacken“, drei Dutzend bocklederne Strümpfe, 36 Paar dicker Fausthandschuhe. Und so weiter.
Kälte, Nebel und mögliche Eisberge erschweren die Fahrt
Am 15. Juni stechen die Hansa und die Germania in See, am Heck die schwarz-weiß-rote Flagge des Norddeutschen Bundes. Das Wasser liegt ruhig, die Wiesen am Deich leuchten hellgrün. In den ersten Tagen bringt die Mehrzahl der Gelehrten „dem Neptun ihr Opfer, wie es später im Expeditionsbericht heißt: Sie werden seekrank.
Die Schiffe segeln nordwärts an der Hochseeinsel Jan Mayen vorbei. Danach wird es richtig kalt. Masten, Takelagen: Alles ist mit einer Eiskruste überzogen. Treibeis schwimmt im Meer. Seehunde und Narwale zeigen sich. Der Ausguck muss ständig besetzt sein, um auf Eisgang reagieren zu können. Und dann kommt auch noch Nebel hinzu. Um nicht getrennt zu werden, tuten beide Schiffe Tag und Nacht mit ihren Nebelhörnern.
Trotz tutender Nebelhörner verlieren sich die beiden Schiffe
In finsterer Nacht verlieren sie sich dennoch – nicht nur aus den Augen, sondern auch aus den Ohren. Sie feuern Kanonen ab, um Kontakt aufzunehmen. Vergeblich. Schuld war eine Kommunikationspanne: Als die Germania signalisieren wollte, dass die Hansa sich nähern solle, verstand diese, sie solle Fahrt aufnehmen. Also setzte der Kapitän die Segel und fuhr in die Dunkelheit davon. Als die Männer bemerken, dass sie das Flaggensignal falsch verstanden hatten, ist es längst zu spät. Dennoch bleibt die Stimmung optimistisch. Denn die Schiffe haben einen Treffpunkt ausgemacht: die Sabine-Insel vor Grönland.
Wir fangen an, über unsere widerwärtige Lage verstimmt zu werden.
Reinhold Buchholz, Bordarzt
Aber die Versuche der Hansa, dorthin vorzudringen, scheitern: Das Wetter wird schlechter, die Eisschollen immer dicker. Der Wind flaut ab. „Das Eis ist so dicht, dass das Schiff, obwohl wir etwas offenes Wasser voraussehen, im Segeln doch so gut wie still liegt“, schreibt Reinhold Buchholz, der Bordarzt, ins Tagebuch. „Wir fangen an, über unsere widerwärtige Lage verstimmt zu werden.“
Ab und an bricht das Eis auf, und die Hansa kommt ein winziges Stück vorwärts. Die Crew versucht, in Richtung Land zu „warpen“: Die Männer ziehen das Schiff mit Tauen oder drücken es mit Stangen vorwärts. „Doch kaum, dass wir ein Fleckchen freimachen, schiebt sich wieder eine Scholle vor“, schreibt der Geologe Gustav Laube. „Zu Mittag machen wir ellenlange Gesichter und ergeben uns resigniert in unser Schicksal, unsere Mission als gescheitert zu betrachten.“ Schließlich fährt ein Teil der Besatzung mit einem der Beiboote voraus. Am Horizont entdecken die Männer die Sabine-Insel, das Ziel.
Dort ist die Germania, die einen Dampfantrieb hat, längst angekommen. Doch für die Hansa gibt es jetzt endgültig kein Manövrieren mehr. Das Eis treibt das Schiff sogar weg vom Land. Bald ist die Küste nicht mehr zu sehen. „Für den schlimmsten Fall stehen die Boote, vollständig ausgerüstet auf dem Verdeck, sodass wir jeden Augenblick mit denselben loslegen können“, schreibt Dr. Laube ins Tagebuch.
Das Eis hat die Hansa schwer beschädigt – Die Mission scheitert
Am 14. September geben die Männer die Hoffnung, sich befreien zu können, auf. Sie richten es sich auf ihrer Eisscholle ein, laufen Schlittschuh, beobachten Nordlichter, jagen Eisbären. Es ist minus 12 Grad kalt. Aus Kohlebriketts, die zur Verfeuerung auf der Germania vorgesehen waren, errichten die Männer eine Hütte. Die Fugen dichten sie mit Wasser ab, das in Sekundenschnelle gefriert. Als Dach nehmen sie ein Segeltuch. Eine Tür wird gezimmert, der Boden mit Kohle ausgelegt.

Nach dem Untergang der Hansa lebt die Mannschaft in einer provisorischen Hütte auf einer treibenden Eisscholle. Die Rettungsboote sind stets seeklar
Am 3. Oktober ist das Haus fertig – gerade bevor ein Unwetter losbricht. Das Schneetreiben verschüttet Haus und Schiff. Gleichzeitig bricht durch den Wellengang unter der Scholle das Eis auf. Die Hansa verliert ihren Halt und kippt nach Steuerbord. Alle Mann müssen in den Schneesturm hinaus, um das Schiff mit Tauen und Ketten zu befestigen, da es abzutreiben droht.
Die Hansa ist nur noch ein Wrack
Die Luft klart wieder auf, doch die Temperaturen fallen weiter. Das aufgebrochene Meer friert wieder zu, Schollen türmen sich auf, das Eis beginnt zu pressen. Das Schiff zittert. Allmählich fragen sich die Männer, wie lange die Hansa das noch aushalten wird. Vorsichtshalber schaffen sie Vorräte auf die Scholle und in ihr Kohlehaus.
Das Kohlehaus war fortan für die lange arktische Winternacht unsere einzige Zufluchtsstätte, vielleicht auch unser Sarg.
Das Schiff hebt sich am Bug, doch noch halten die Planken. Immer mehr Eisblöcke schieben sich unter den Rumpf. Am 19. Oktober stellen die Männer fest, dass Wasser ins Schiff dringt. Das Leck wird unter den Kohlenvorräten vermutet. Unmöglich, es abzudichten. Ein Teil der Mannschaft pumpt Wasser aus dem Schiff, um den Untergang hinauszuzögern. Alle anderen retten, was zu retten ist. Sogar die Masten sägen sie ab und schaffen sie aufs Eis. „Nun bot die Hansa erst vollständig den trostlosen Anblick eines Wracks dar“, schreiben die Forscher. „Das Kohlehaus war fortan für die lange arktische Winternacht unsere einzige Zufluchtsstätte, vielleicht auch unser Sarg.“
Die Versuche, das Schiff zu retten, waren anstrengend gewesen. Die Männer erholen sich in ihrem Kohlehaus. Der Koch bereitet Fleischbrühe zu. Abends wird Whist gespielt, ein Kartenspiel. Der Ofen funktioniert: Bei Außentemperaturen von minus 20 Grad gelingt es, das Haus auf 18 Grad zu heizen.
Das Eisfeld treibt langsam nach Süden und nimmt die Schiffbrüchigen mit. Ihre Reise führt sie in etwa parallel zur Küste. Bei klarem Wetter ist das rettende Ufer zu sehen. Doch jedes Mal, wenn die Männer versuchen, es zu erreichen, scheitern sie am brüchigen Eis.
Dosengemüse und Brühe sind jetzt die Hauptlebensmittel. Die Männer spalten Holz und flicken Kleider. Sie schreiben Tagebuch und führen astronomische Beobachtungen durch. Sie errichten weitere Häuser aus Schnee, einen Waschraum und einen Schuppen.
Weihnachten im ewigen Eis
„Am Heiligen Abend war starker Schneefall, der unser Haus so tief begrub, dass man am anderen Morgen über das Dach wie über ebenen Boden schritt.“ An die ständige Todesgefahr haben die Männer sich gewöhnt. Aus Tannenholz bauen sie einen Weihnachtsbaum. Die letzten Reste Portwein werden ausgeschenkt. „Wenn diese Weihnachten die letzten sind, die wir erleben, so waren sie immer noch schön genug“, schreibt Dr. Laube.
Schon am zweiten Weihnachtstag sieht es so aus, als wäre das Ende da. Erneut ist ein Sturm aufgezogen. Die Scholle gerät in Bewegung. Das Eis knarrt, poltert, sägt. „Als ob unheimliche Geister unter unserer Scholle ihr Wesen trieben“, beschreibt es das Expeditionstagebuch. Fluchtartig retten sich die Männer in die Boote. Doch die Scholle hält. Abends kehren sie in ihr Haus zurück und versuchen zu schlafen. Doch es gelingt nicht.
Am nächsten Morgen stellen die Männer mit Schrecken fest, dass große Teile der Eisscholle abgebrochen sind. Das Haus steht nur noch 200 Schritte vom Ufer entfernt. Und die Winterstürme werden immer heftiger.
Man sagt sich bereits Lebewohl
Am 11. Januar schlägt die Wache erneut Alarm. Weil der Hauseingang verschneit ist, fliehen die Männer durch ein Loch im Dach. „Der Aufruhr der Elemente, der uns hier empfing, übertraf alles hier Erlebte. Dicht zusammengedrängt suchten wir, kaum aus der Stelle könnend, dem grausen Unwetter standzuhalten.“
Wieder bröckelt die Scholle an den Rändern. Plötzlich klafft sie zwischen dem Wohnhaus und dem Holzvorrat auf. Eine Eisspalte! Auf einem abgesprengten Stück Scholle treibt das Brennholz in die tobende See. Auch eines der Rettungsboote droht abzutreiben. Im letzten Moment können die Männer es sichern. „Wir sagen uns Lebewohl und reichen einander zum Abschied die Hände, denn schon der nächste Moment kann den Untergang bringen“, schreibt Dr. Laube. Eine neue Eisspalte reißt jetzt auch das Haus entzwei. Nun sind sie obdachlos.
Wir sagen uns Lebewohl und reichen einander zum Abschied die Hände, denn schon der nächste Moment kann den Untergang bringen.
Dr. Gustav Carl Laube, Forscher
Die Nacht verbringen sie frierend in den Rettungsbooten. Nur die Wagemutigsten trauen sich noch einmal in das zerbrochene Haus. Dem Koch gelingt es, in den Trümmern Kaffee zu machen. Doch wohnen kann man dort nicht mehr. Von nun an schlafen die Männer in den Rettungsbooten. Aus den Trümmern des Hauses versuchen sie, eine neue, kleinere Wohnstätte zu errichten. Doch bereits in der ersten Nacht fegt der Eiswind das Dach herunter.

Nachdem das Eis unter der Hütte weggebrochen ist, muss die Mannschaft in die Rettungsboote umziehen
Schließlich, nach Wochen, legt sich der Sturm. Der Frühling naht, manche sind jetzt sogar wieder zu Scherzen aufgelegt: Solange er Tabak habe, mache er sich aus all dem gar nichts, sagt der Koch. Doch die Männer befinden sich in erbärmlichem Zustand. Das Wohnen im Kohlehaus hat ihre Gesichter pechschwarz gefärbt. Rasiert oder gar frisiert hat sich seit der Abreise aus Bremerhaven niemand.
Anfang Februar tauchen wieder Tiere auf, Seehunde, ein Polarfuchs, Vögel. Die Scholle hat jetzt Fahrt aufgenommen. Sie hat die Meerenge zwischen Island und Grönland verlassen. In dieser Region könnte es Ureinwohnersiedlungen geben, haben die Männer in alten Büchern gelesen. Daran, dass es Kannibalen sind, wie manche Chronisten behaupten, glauben sie nicht.
Der Schiffsarzt ist nervlich am Ende
Nur der Schiffsarzt Dr. Buchholz beginnt, sich seltsam zu verhalten. „Er hat alle Liebe zum Leben verloren“, notiert Steuermann Wilhelm Bade. Buchholz verlässt den Schlafsack nicht mehr. „Wir müssen ihn füttern, damit er nicht verhungert.“ Wenig später wird er auch paranoid, wittert Verschwörungen, bekommt Tobsuchtsanfälle, schlägt und beißt. Nachts wird er an seiner Liege festgebunden. Als seine Bewacher ihn für einen Moment unbeobachtet lassen, stürzt Buchholz sich von einer Anhöhe hinab. Zwei Mann bergen ihn mit einem Seil. Dass er sich bei dem Suizidversuch verletzt hat, hat den Vorteil, dass er anschließend leichter zu bändigen ist.
Dennoch wird er noch mehrmals versuchen, sich umzubringen. Bis zum Ende der Expedition muss er bewacht, getragen und versorgt werden.
Land in Sicht – die Boote werden klargemacht
Ende März erreicht die Eisscholle die Höhe von Nukarbik, eine Insel vor der Südostküste Grönlands. Die Hansa-Männer meinen, Feuer an Land zu sichten. Sie zünden Raketen, doch niemand reagiert. Also versuchen sie, zum Land durchzustoßen. Doch das Eis ist für die Boote zu dick und für den Fußmarsch nicht tragfähig. Sie bleiben auf der Scholle gefangen, der wechselnden Strömung ausgeliefert. Vier quälende Wochen treiben sie in der Bucht von Nukarbik im Kreis, das Land stets vor Augen – und doch unerreichbar.
Ostermontag treibt ein Sturm die Scholle aus der Bucht und endlich wieder nach Süden. Doch noch immer zeigt sich kein schiffbares Wasser. Der Schnee geht in Regen über, die Männer werden nass, die Eiswände ihres Schneehauses tauen und müssen mit Balken abgestützt werden.
Da zeigt sich am Morgen des 7. Mai endlich freies Wasser in Richtung des Landes! Über Nacht hatte der Wind den Himmel aufgeklart und die Eisschollen, die den Weg zum Ufer versperrten, weggeweht. Kurz vor Mittag beruft Kapitän Hegemann eine Versammlung ein. Sollten sie ihre Eisscholle, die ihnen immerhin eine gewisse Sicherheit gibt, nun wirklich verlassen? Fast alle sind dafür.
Ein letztes Mittagessen. Dann werden die Boote klargemacht. Über die getreue Scholle notiert sich Dr. Laube: „Unter zahllosen Gefahren und Drangsalen hatte sie uns aus Regionen des Schreckens und des Todes 200 Tage hindurch bis hierher getragen.“
Bis in den Abend segelt die Mannschaft Richtung Küste, dann stockt die Fahrt. Immer wieder friert das Fahrwasser zu. Jetzt geht auch noch der Proviant aus. „Die knappen Rationen, zu denen wir gezwungen sind, lassen uns nie ganz satt werden“, schreibt Bade. „Unser Appetit ist grenzenlos.“ Alle Gespräche drehen sich nur ums Essen. Einzig Tabak ist im Überfluss vorhanden.
Doch endlich ist der Frühling da, das Thermometer ist auf 18 Grad gestiegen. Die Männer hoffen auf die Kraft der Sonne. Doch das Eis schmilzt nicht. Also versuchen sie, die Boote mit Muskelkraft über das Eis zu ziehen. Mit um die Schultern gespannten Gurten treten sie den drei Meilen langen Weg zur Insel Illuidlek an, die in Sichtweite liegt. Heftiger Schneefall stoppt immer wieder alles Vorwärtskommen. Das Meereis ist vielfach geborsten, voller Trümmer und sich auftürmender Schollen. Um nicht schneeblind zu werden, gehen die Männer nur nachts. Die letzten Stiefel zerreißen im Eis. Von Scholle zu Scholle kämpfen sie sich. Seit 21 Tagen sind sie in den Booten. Sie arbeiten bis zur Erschöpfung. Eines Morgens fällt selbst der Kapitän in Ohnmacht.
Am 4. Juni endlich gelingt die Landung auf der Insel. Doch gerettet sind sie hier, jenseits jeglicher Zivilisation, noch nicht. Der Proviant reicht noch für 14 Tage. Zum Glück gibt es Seevögel zuhauf. Die Männer schießen sie zu Dutzenden. Doch sie müssen weiter. Am 6. Juni besteigen sie erneut die Boote.

Die Schiffbrüchigen erreichen den Außenposten Friedrichsthal – und werden dort auf Deutsch begrüßt
Nun wird das Wasser freier. An Land zeigen sich erste Pflanzen, ganze Wiesen! In den Beibooten umrunden sie die Klippen der Südostküste Grönlands, Kaps und Schären, durchqueren Fjorde, passieren Inseln. Sie übernachten in Buchten, waschen sich unter Wasserfällen. Sie entdecken Überreste von Eskimosiedlungen: kleine, zu Vierecken zusammengelegte Steine, Knochen von Seehunden, Scherben von Steingut.
In Friedrichsthal geht es Berg auf
Am 13. Juni erreichten sie die Missionsstation Friedrichsthal, den südöstlichsten europäischen Außenposten auf Grönland. Sie besteht aus einem großen, rot gestrichenen Haus, das mit einem Türmchen versehen ist – Kirche, Schule und Wohnhaus in einem. Rundherum wohnen die Ureinwohner, obwohl sie getauft sind, in traditionellen Hütten. Am Strand sammeln sich Menschen zur Begrüßung, ein Kajak eilt den Hansa-Booten entgegen. „Willkommen in Grönland!“, ruft ein europäisch aussehender Mann – auf Deutsch!

In Friedrichsthal treffen die Deutschen erstmals auf Ureinwohner. Von ihnen lernen sie die Heringsjagd und das Kajakfahren.
Friedrichsthal ist eine Station der Herrnhuter Brüdergemeine, die sich während der Reformation gegründet hat. Die Gastgeber kochen Weinsuppe, Ziegenbraten und Kartoffelmus. Sie statten die Schiffbrüchigen mit Kleidung aus. „Die lang entbehrte europäische Reinlichkeit, das Gefühl, wieder in einen Kreis getreten zu sein, wo eine deutsche Hausfrau ihre wohltuende Tätigkeit entfaltet, wirkte wie ein beglückender Zauber auf uns.“
Mit den Ureinwohnern schließen die Hansa-Männer Freundschaft. Sie staunen, dass die Eingeborenen schreiben können und sogar die Kirchenorgel spielen. Sie gehen mit ihnen auf Heringsjagd. Doch als sie hören, dass im Hafen Julianehaab die Constance erwartet wird, das letzte Schiff, das in diesem Jahr nach Europa fährt, zieht es sie zum Aufbruch. Die Hansa-Männer wollen jetzt nur noch nach Hause.
Die Constance bringt die Mannschaft nach Hause
Am 3. Juli um elf Uhr legt die Constance endlich ab. Acht Wochen später passiert sie die Shetlandinseln. Die Hansa-Männer an Deck halten nun Ausschau nach Landsleuten, nach Fischern auf der Doggerbank. Doch sie sehen nur Holländer und Norweger. Erst als bei Skagen ein Lotse an Bord geht, erfahren sie, warum: Der deutsch-französische Krieg ist ausgebrochen!
Anfang September erreichen sie Kopenhagen. Hier können sie erstmals in die Heimat telegrafieren. An jedem anderen Tag hätte die Rückkehr der Verschollenen die Nation bewegt. Doch es ist kein gewöhnlicher Tag. Es ist der Tag des Sieges über die Franzosen bei Sedan. Ganz Deutschland befindet sich im Taumel. Die Rückkehr der Seeleute geht vollkommen unter.
Auch die Germania hat es geschafft
Zwei Tage später überqueren die Überlebenden bei Fredericia die deutsche Grenze. Mit der Schnelldroschke geht es nach Bremen. Dort erkundigen sie sich nach dem Schicksal ihres Schwesterschiffs, der Germania. Sie ist noch nicht zurück! Sollte es ihr am Ende noch schlechter ergangen sein als der Hansa?
Nein, denn am 11. September taucht die Germania vor Bremerhaven auf. Am Abend liegen sich die Besatzungen beider Schiffe, die sich mehr als ein Jahr zuvor im Nebel des Nordmeers verloren hatten, in den Armen.
Der Text ist in P.M. History Ausgabe 01/2020 erschienen.